Berlin (dpa)
Konsum und Klima: Warum weniger beim Shoppen mehr ist
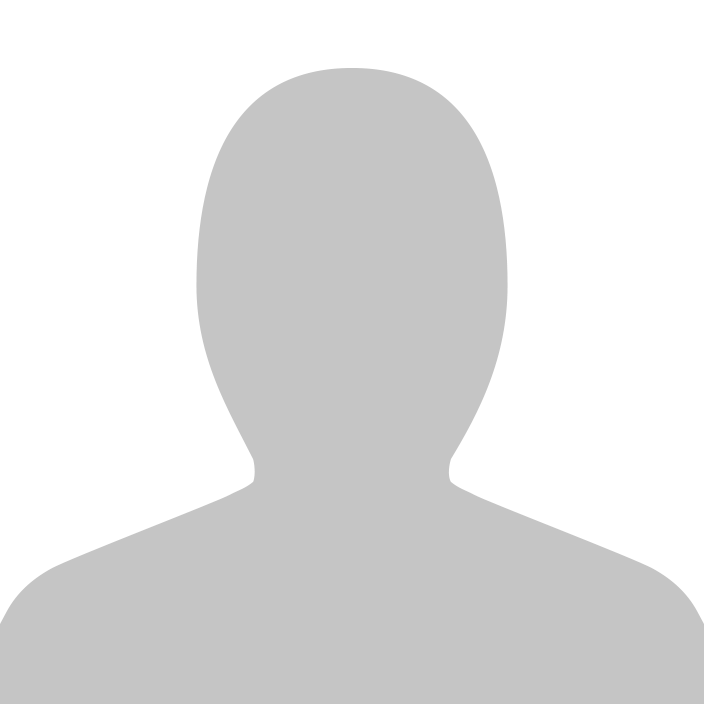

Dass weniger Konsum der Umwelt und dem Klima nutzt, ist fast allen Menschen klar. Und doch kaufen viele gern und viel mehr, als sie wirklich brauchen. Wie kann der bewusste Verzicht gelingen?
Mit wenigen Klicks zum neuen Winterpulli, für ein paar Euro zum Möbel-Schnäppchen – Shoppen ist in unserem Alltag sehr bequem und vielfach auch kostengünstig geworden. Oft wird nicht lange überlegt, viele Kaufentscheidungen werden fast beiläufig getroffen.
Experten warnen: Maßloses Kaufverhalten zerstört unseren Planeten. Der kanadische Umweltjournalist James Bernard MacKinnon etwa mahnt in seinem Buch „Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen“, der Konsum habe das Bevölkerungswachstum als größte Bedrohung für die Umwelt überholt. Warum aber shoppen viele Menschen so gern? Und wie kann bewusst reduzierter Konsum gelingen?
Konsum hat aus Sicht der Diplom- und Wirtschaftspsychologin Petra Jagow in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert: „Oft gilt: "Ich kaufe, also bin ich". Wir shoppen gerne in Situationen, wo es uns nicht gut geht. Dann gönnen wir uns was und entschädigen uns“, sagt sie. Im Shopping liege für viele eine Aufwertung des eigenen Alltags, eine Möglichkeit der Unterhaltung und Ablenkung.
Der Gedanke, immer die neueste Mode, das schickste Auto und die modernste Innenausstattung haben zu wollen, entstehe durch das grundlegende Bedürfnis, sich selbst aufwerten zu wollen, erklärt Marktforscherin Jagow. „Das ist dieses persönliche egoistische Motiv, das sehr stark sein kann.“ Umweltpsychologe Frank Esken erklärt, entwicklungspsychologisch sei der Wunsch nach Anerkennung durch andere beim Menschen stark verankert. „Wir haben immer die Gesellschaft um uns herum, an der wir uns sehr stark orientieren.“
Stelle man nun Nachhaltigkeit in den Fokus, bedeute das Veränderung und Verzicht, sagt Jagow. „Verzicht fällt uns allen schwer, freiwilliger Verzicht noch mal mehr.“ Klimafreundliches Konsumverhalten sei für die meisten nur dann attraktiv, wenn die nachhaltige Alternative als ebenso gut wahrgenommen würde – und als Zusatz noch ein gutes Gefühl entstehen lasse.
Die Marktforscherin betont, wie wichtig es sei, auf dem Weg zu nachhaltigem und klimaneutralem Konsum bei Käuferinnen und Käufern „etwas auf der gefühlsmäßigen Ebene zu bewegen“. Das soll heißen, dass ihnen der Zusammenhang zwischen ihrer Kaufentscheidung und den möglichen Auswirkungen deutlich werden müsse, etwa wenn für Discountmode Menschen in ärmeren Ländern in Fabriken unter teils gesundheitsgefährdenden Bedingungen arbeiten müssten. „Das geht über Bilder, gute Reportagen und Dokumentationen“, so Jagow.
Experten sind sich einig: Ohne Minus beim Shoppen lassen sich Klima und Umwelt schwerlich schützen. Wie gravierend die Folgen des Verzichts allein in der Textilindustrie für das Klima wären, hebt Umweltjournalist MacKinnon in seinem Buch hervor: „Würde die weltweite Textilproduktion für ein Jahr eingestellt, so bewirkte dies genauso viel wie ein Stopp des gesamten internationalen Flugverkehrs und der Güterbeförderung auf dem Seeweg für den gleichen Zeitraum.“
Um sich von dem Drang ständigen Konsums zur Aufwertung freizumachen und sich mit weniger wohlzufühlen, dürfe man sich nicht mehr so stark mit anderen und ihren Besitztümern messen, sagt Hochschulprofessor Esken. Das scheine leichter gesagt als getan: Viele knüpften ihr persönliches Wohlbefinden schließlich direkt daran, materiell gut dazustehen. Autor MacKinnon stellt allerdings heraus, dass Materialismus letztlich keineswegs das Wohlbefinden fördere – das habe die Forschung gezeigt. Materialistische Werte schafften keine geistige Gesundheit, keine dauerhafte Geborgenheit oder Zufriedenheit und kein Glück. Vielmehr bestehe ihre Funktion darin, „Angst zu schüren, Unsicherheit zu wecken und uns aus dem Bett zu treiben, damit wir uns in der Welt behaupten“, so MacKinnon.
Die Experten kommen zu dem gleichen Schluss: Bei uns selbst braucht es eine gesteigerte Wertschätzung unserer Sachen, um sie nicht jede Saison durch neuste Modelle zu ersetzen. Jagow empfiehlt konkret, vor dem Shopping-Bummel ganz bewusst den eigenen Kleiderschrank gründlich durchzusehen. „Dann merke ich, was ich eigentlich alles noch habe und dass das für die nächste Saison oft noch völlig ausreichend ist. Im Geschäft, im Kaufrausch ist der Gedanke nämlich oft weg.“
Doch auch auf gesellschaftlicher Ebene müsse ein Wertewandel stattfinden, sagt Esken: So dürfe jemand, der – auch durch freiwilligen Verzicht – weniger habe, nicht als jemand gelten, der sich etwas nicht leisten könne. Nötig sei ein allgemeines Umdenken dahingehend, dass materielle Besitztümer nicht die einzigen Werte seien, die jemanden im Ansehen anderer Menschen förderten. „Da muss es weniger darum gehen, materielle Statussymbole und damit eine bestimmte Stellung zu zeigen, sondern eher, dass man ein Umweltbewusstsein hat. Das könnte auch so etwas werden wie ein Statussymbol“, regt Esken an.
Expertin Jagow betont, wie wichtig es sei, sich darauf zu besinnen, dass letztlich jede und jeder individuell entscheide, wie sich Selbstwert definiere: „Ich lege fest, ist mein Selbstwert von Statussymbolen abhängig oder nicht.“ Ihrer Meinung nach festigt sich gesellschaftlich immer mehr die Position, dass Kommerz nicht automatisch Stärke symbolisiert. „Da findet eine Umwertung statt.“
Im allgemeinen Kaufverhalten sieht Jagow einen sich immer klarer abzeichnenden Umbruch: Bei vielen Menschen sei es mittlerweile ein klares Abwägen, ob wirklich neue Mode gekauft werden müsse. Corona habe einen großen Beitrag geleistet, sagt die Marktforscherin. Viele hätten während der Lockdowns ausgemistet und gesehen, wie viele Dinge sie besäßen. Viele kauften nun bewusster und weniger spontan ein. Und wenn, dann werde verstärkt etwas wirklich Qualitatives gekauft, was lange halte.
Jagow und Esken beobachten in diesem Kontext, dass insbesondere die junge Generation stärker für bewussten und reduzierten Konsum sensibilisiert ist – und beispielsweise nicht immer die neuste Mode oder das neuste Handy haben müsse.
© dpa-infocom, dpa:211101-99-814053/2



