Blantyre/Maputo (dpa)
Wie der Klimawandel Afrika noch ärmer macht
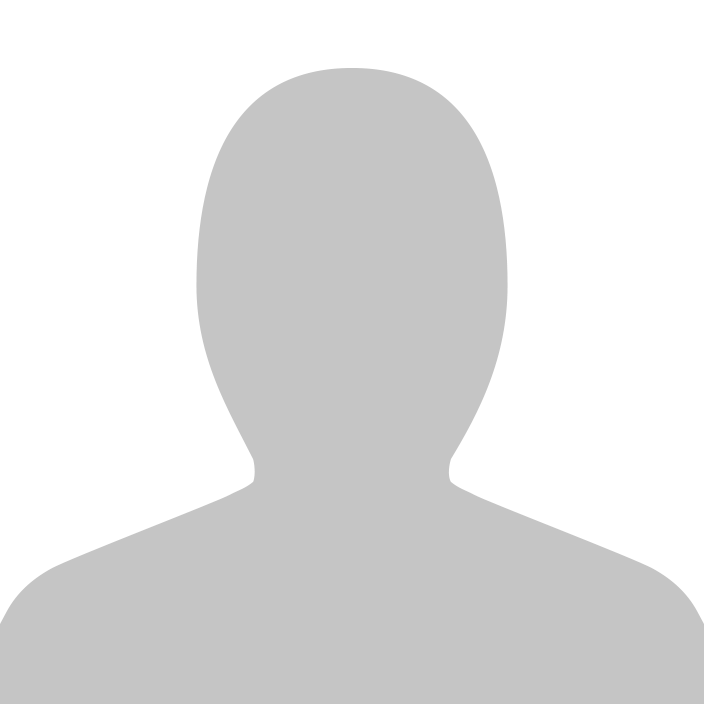

In vielen Teilen Afrikas ist Klimawandel nicht nur Theorie: Menschen kämpfen bereits mit den Folgen - und ums Überleben. Fünf der zehn am meisten vom Klimawandel betroffenen Länder liegen in Afrika.
Die Nacht, in der ihr Mann in den Fluten ertrank, hat sich in Malita Tembos Erinnerung geätzt. Die Familie wurde aus dem Schlaf gerissen, als die Mauern ihrer Lehmhütte im Dorf Nyachikadza im Süden Malawis einstürzten.
Draußen peitschte ein Sturm der später Idai genannt und von UN Generalsekretär Antonio Guterres als „eine der größten wetterbedingten Katastrophen in der Geschichte Afrikas“ bezeichnet wurde.
Idai zerstörte im März 2019 binnen weniger Stunden das Dorf und viele andere Gegenden in Mosambik, Simbabwe und Malawi. Die sintflutartigen Regenfälle und extremen Winde mit Höchstgeschwindigkeiten von 195 Stundenkilometern richteten nach Angabe der Weltbank Schäden in Höhe von 1,72 Milliarden Euro an. Drei Millionen Menschen waren betroffen; mehr als 1000 starben.
„Eine Nacht gefüllt von Schreien“
„Es war eine Nacht gefüllt von Schreien, als ein Haus nach dem anderen fiel“, erinnert sich Tembo unter Tränen. Die Regierung habe ihr im Anschluss ein Zelt sowie eine Parzelle, zwei Säcke Saatgut und Dünger zugeteilt - doch das habe nicht gereicht, um von vorne anzufangen. Jeden Tag kämpft die 27-jährige Mutter zweier Kleinkinder ums Überleben. „Wir kommen auf keinen grünen Zweig“, sagt sie.
Fünf der zehn am meisten vom Klimawandel betroffenen Länder liegen nach Angaben der Umweltorganisation Germanwatch in Afrika. Das südafrikanische Mosambik ist demnach das am schlimmsten betroffene Land der Welt; gefolgt vom benachbarten Simbabwe. Auch Mosambiks nördlicher Nachbar Malawi, der westafrikanische Niger und der Südsudan am östlichen Horn Afrikas gehören zu den Top Ten.
Keine Mittel zum Katastrophenschutz und Wiederaufbau
Für arme Länder sind die Auswirkungen des Klimawandels besonders fatal, da den Regierungen die finanziellen Mittel zum Katastrophenschutz und Wiederaufbau fehlen. Oft liegen ganze Regionen für viele Monate - wenn nicht Jahre - brach. Wichtige Wirtschaftssektoren wie die Landwirtschaft sowie Wasser- und Stromversorgung sind unterbrochen. Krankheiten breiten sich aus, zerstörte Ernten bedeuten langfristig Hunger.
So war es auch für Francisco João Amade, der in Mosambiks nördlichem Macomia Distrikt zuerst sein Hab und Gut aufgrund von Zyklon Idai verlor. Wenige Wochen später kam der zweite Schicksalsschlag: Wirbelsturm Kenneth fegte Amade buchstäblich das Dach über dem Kopf weg. Kenneth richtete mit 200 Stundenkilometern und Fluten mit 2,5 Metern Höhe auch in Teilen Tansanias und auf der Inselgruppe Komoren große Zerstörung an.
Afrikanischer Kontinent erwärmt sich schneller
Amade lebt seitdem mit seiner Frau, drei Kindern und einigen Verwandten auf engstem Raum in einer kleinen Hütte, die er behelfsmäßig aus Trümmerteilen zusammengenagelt hat. Der 29-jährige Kleinbauer hat ein paar Bananenstauden und Zuckerrohr angepflanzt. Von den Einnahmen kann er grade mal ein paar Säcke Reis, Öl und Seife für seine Familie erwerben. Für mehr reicht es nicht.
Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) werden 118 Millionen Menschen in Afrika bis 2030 Dürre, Überschwemmungen und extremer Hitze ausgesetzt sein. Der Kontinent erwärme sich demnach stärker und schneller als der globale Durchschnitt - und das obwohl Afrikas 54 Länder weniger als vier Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen produzieren.
Politiker schlagen auf Weltklimagipfel Alarm
Die Kombination aus Klimawandel und der Corona-Pandemie habe bereits das verarmte Malawi in die Knie gezwungen, warnte Präsident Lazarus Chakwera jüngst im Vorfeld der nun laufenden UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow. „Wir müssen dringend in Anpassungsmaßnahmen investieren“, sagte Chakwere dem staatlichen Fernsehsender MBC. Für die Finanzierung der Projekte blickt er Richtung Westen.
Auch in Simbabwe, das seit vielen Jahren in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt, kommt die Regierung der Zerstörung nicht nach. „Wenn der Klimawandel im derzeitigen Tempo weitergeht, werden Tausende von Simbabwern ihre Arbeit, ihr Zuhause oder sogar ihr Leben verlieren“, warnte Präsident Emmerson Mngangagwa auf Twitter.
Zyklon Idai folgten dieses Jahr die tropischen Wirbelstürme Eloise und Chalane. Viele Simbabwer mussten bereits mehrfach flüchten.
Hundertausende von Dürren und Fluten betroffen
Die Simbabwerin Enita Mauraye haust bereits seit zwei Jahren in einer vom Roten Kreuz errichteten Zeltstadt ohne fließendes Wasser und Elektrizität in der Nähe der östlichen Kleinstadt Chimanimani. Ihre fünfjährige Tochter wurde von den Fluten Idais mitgerissen. Anstatt die Schule zu besuchen, versuchen die drei überlebenden Söhne, der Mutter mit Hilfsjobs unter die Arme zu greifen. Die Regierung habe versprochen, neue Häuser zu bauen, doch beim Versprechen sei es geblieben, erzählt die 52-jährige. Hoffnung auf eine bessere Zukunft wagt sie kaum zu hegen.
Weiter nördlich leidet der Wüstenstaat Niger an sich abwechselnden Dürren und Fluten. Als der Niger-Fluss vor wenigen Wochen in rasantem Tempo über die Ufer trat, waren mehr als 210.000 Menschen - die Hälfte davon Kinder - betroffen. Im Dorf Kiskisoye, unweit der Hauptstadt Niamey, verlor Bauer Abdou Aziz Soumana seine gesamte Reisernte. „Wir wissen überhaupt nicht, wie wir überleben sollen“, sagt der 54-jährige Vater von acht Kindern verzweifelt. Die Wetterveränderungen seien katastrophal, seit Jahren gingen die Erträge zurück, sagt Soumana: „Wir haben lange nicht an Klimawandel geglaubt, aber jetzt denken wir wirklich, dass es ihn gibt.“
© dpa-infocom, dpa:211103-99-843002/4



