Przemysl (dpa)
Rückkehrer nach Kiew: „Auch an Krieg kann man sich gewöhnen“
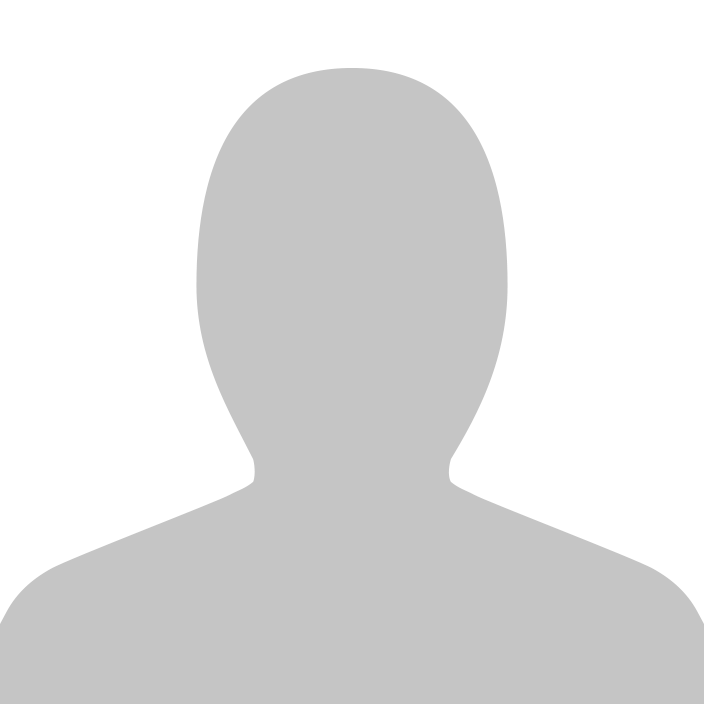

Viele Ukrainer kehren zurück in die Gebiete, die ihre Armee wieder kontrolliert. Sie sind enttäuscht von ihrem Dasein als Flüchtlinge. Doch was zieht Ausländer in das vom Krieg verwüstete Land?
Schon eine Stunde vor Abfahrt des Zuges nach Kiew hat sich vor dem Bahnhof Przemysl im Süden Polens eine lange Schlange gebildet. Hunderte Menschen warten geduldig vor der Passkontrolle.
Dahinter steht auf einem Sondergleis in russischer Breitspur der silberglänzende Intercity, der sie in die Ukraine bringen soll.
Antonina Belinska schiebt ihren großen roten Rollkoffer voran. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs vor gut sechs Wochen ist die 40-jährige Kino-Kostümdesignerin aus Kiew geflohen. In Dänemark hat sie Schutz gefunden - und sogar Arbeit in ihrem Fachgebiet. Trotzdem möchte sie jetzt für eine Woche zurück in die Heimat: „Ich kann nicht anders, ich habe einfach große Sehnsucht nach meinem Freund.“ Die Sicherheitslage habe sich gerade etwas entspannt, meint Antonina. „Auch an den Krieg kann man sich gewöhnen.“
Weniger Menschen fliehen aus der Ukraine
So wie sie denken derzeit offenbar viele Ukrainer. Zuletzt hat die ukrainische Armee einige Städte und Regionen vor allem in Norden zurückerobert, die Russen konzentrieren sich mit ihren Angriffen auf den Osten des Landes. Momentan fliehen weniger Menschen aus der Ukraine als in den ersten Kriegswochen - und mehr trauen sich wieder in ihr Land hinein.
Das zeigen die Zahlen des polnischen Grenzschutzes. Am Sonntag etwa kamen 28.500 Menschen aus der Ukraine in Polen an - ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu März. Am gleichen Tag passierten 19.400 Menschen die Grenze Richtung Ukraine. Insgesamt sind seit Kriegsbeginn mehr als eine Viertelmillion Männer, Frauen und Kinder von Polen in die Ukraine eingereist.
Am Grenzübergang Medyka 12 Kilometer östlich von Przemysl ist die Veränderung zu spüren. Der große Andrang mit stundenlangen Wartezeiten ist vorbei - zumindest vorerst. Aus der Ukraine kommen kleine Grüppchen von Geflüchteten. Ihre Zahl hält sich fast die Waage mit denjenigen, die nach Osten in die Ukraine unterwegs sind.
Schlecht ausgehalten, „fremdes Brot“ zu essen
Vor dem Bahnhof in Przemysl kommt die Schlange der Passagiere für den Zug nach Kiew langsam voran. Rentner Vitalij (73) will in seine Heimatstadt Tschernihiw. Am 20. März ist er mit seiner Frau, seiner Tochter und drei Enkelkindern nach Polen geflohen. Die Familie ist in einem Kloster im südpolnischen Tuchow untergebracht. Doch Vitalij kehrt nun allein zurück. „Ich muss Kartoffeln pflanzen. Mein Haus steht noch, das vom Nachbarn haben sie bombardiert.“ Er habe es nur schlecht ausgehalten, „fremdes Brot“ zu essen, sagt der alte Mann über seine Zeit in Polen. Und fügt fast trotzig hinzu: „Zuhause ist es immer besser.“
Auch Tamara (70) und ihre Tochter Irina (42) wollen nach Kiew zurück. Anfang März sind sie nach Polen gekommen. Die Menschen im Nachbarland hätten sie mit großer Gastfreundschaft aufgenommen. „Hier ist es ruhig, es fliegen keine Granaten. Aber es ist eben kein Zuhause“, sagt Tamara über Polen. Und Irina erzählt, der Chef des Schönheitssalons, in dem sie in Kiew als Kosmetikerin arbeitete, habe schon alle Angestellten gebeten, wieder zurückzukehren, weil der Betrieb wieder losgehe.
Greg aus Michigan trägt einen riesigen Rucksack auf dem Rücken und zieht zwei schwere Taschen im Camouflage-Look hinter sich her. Sechs Jahre habe er in der US-Armee gedient, auch in Afghanistan sei er gewesen, erzählt der 27-Jährige mit dem dunklen Vollbart. Jetzt will er in der Ukraine kämpfen. „Ich möchte das ukrainische Volk von dem Bösen befreien, das Putin ihm antut.“
Auch John aus North Carolina will die Ukraine von etwas befreien - von den Minen und Blindgängern, die dort herumliegen. Der 69-Jährige aus North Carolina, der seinen Nachnamen lieber für sich behält, arbeitet für die amerikanische Nicht-Regierungsorganisation „Bombenentschärfer ohne Grenzen“. Zusammen mit anderen Spezialisten wolle er der ukrainischen Armee helfen, nicht detonierte Kampfmittel unschädlich zu machen. Am gefährlichsten seien die Sprengfallen, die die Russen in vielen Häusern an scheinbar harmlosen Gegenständen angebracht hätten. „Die sind selbstgebastelt. Da weiß man nie genau, wie sie funktionieren„, sagt der Sprengstoffexperte. Dann steigt er als einer der letzten in den Zug.
© dpa-infocom, dpa:220411-99-881560/3



