Berlin (dpa)
Weniger Rehe für mehr Wald? Streit über neues Jagdgesetz
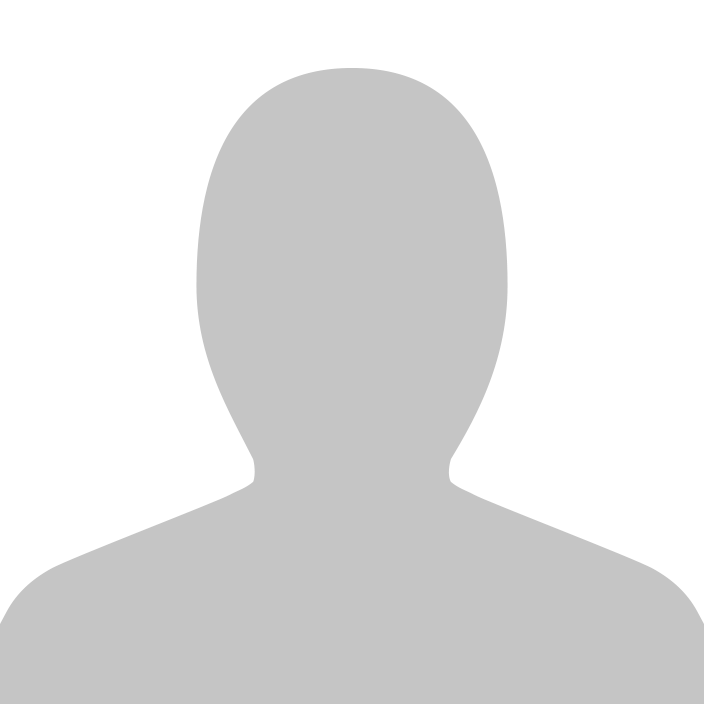
Um den Wald widerstandsfähiger zu machen, sollen zwischen Kiefern und Fichten mehr Laubbäume wachsen. Doch deren Triebe werden von Rehen und anderem Wild gern abgeknabbert. Das bringt Förster und Jäger gegeneinander auf. Kann eine Änderung des Jagdgesetzes helfen?
Um junge Laubbäume zu schützen und Deutschlands Wälder zu stärken, will die Bundesregierung den vermehrten Abschuss von Rehen ermöglichen.
Doch der Entwurf von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) für eine Änderung des Bundesjagdgesetzes stellt bisher weder Förster noch Jäger zufrieden.
Wanderer und Spaziergänger freuen sich, wenn sie ein Reh im Wald entdecken, aus Sicht von Förstern gibt es aber zu viele. Wildverbiss, wie Fachleute sagen, gilt als großes Hindernisse für den „Waldumbau“ - das Umwandeln von Monokulturen in Mischwälder. Dies soll Deutschlands schwer geschädigte Wälder widerstandsfähiger gegen Klimawandel und Schädlinge machen. Und das ist dringend notwendig.
245.000 Hektar, fast die Fläche des Saarlandes, gilt es nach den trockenen und heißen Sommern der vergangenen Jahre wieder aufzuforsten. Stürme, Dürre und Schädlinge wie Borkenkäfer haben dem Wald schwer zugesetzt. Besonders anfällig sind die rund drei Millionen Hektar Kiefern- und Fichtenwälder, in denen sonst wenig wächst - das ist mehr als ein Viertel der gesamten Waldfläche.
Klöckners Vorschlag, um einen „tragfähigen Ausgleich zwischen Wald und Wild“ zu schaffen: Künftig soll es nicht mehr in allen Fällen eine behördliche Abschussplanung für Rehwild geben. Stattdessen sollen Waldbesitzer und Jäger vor Ort sich auf einen jährlichen Mindestabschuss im Jagdpachtvertrag einigen und ihn von den Behörden genehmigen lassen. Klappt das nicht oder ist das Abschuss-Ziel zu gering, legt die Jagdbehörde eine Mindest-Abschussquote fest. „Verbissgutachten“, also Gutachten über abgefressene Bäume, sollen dann einfließen.
Zudem soll das Gesetz festschreiben, dass „eine Naturverjüngung des Waldes im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen möglich sein soll“ - also etwa ohne Schutzzäune um junge Bäume. Man wolle auf „Eigenverantwortung vor Ort“ setzen, erklärte Klöckner dazu.
Der Bund Deutscher Forstleute ist damit in dieser Form nicht glücklich. „In Deutschland haben wir tendenziell fast flächendeckend zu hohe Wildbestände“, sagte der Vorsitzende Ulrich Dohle der Deutschen Presse-Agentur. Jagdmanagement sei ein „ganz wesentlicher Schlüssel“ zum Erfolg beim Waldumbau - neben mehr Forstpersonal, denn das wurde in jüngerer Zeit stark reduziert.
Unzufrieden ist Dohle einerseits mit der Formulierung zur „Naturverjüngung“ - da sollte aus Sicht der Forstleute konkret klargemacht werden, dass es auch um Buchen, Eichen, Ahorn, Eschen und andere gehe, die derzeit oft keine Chance hätten. Außerdem fehlten Waldbesitzern und Jägern teils die sachlichen Grundlagen und manchmal auch die Kompetenz, um festzulegen, wie viel geschossen werden soll. Es brauche amtliche Gutachten über die Vegetation als Grundlage. In Bayern sei das lange etabliert, dort laufe es mit der Waldverjüngung deutlich besser als im Rest Deutschlands, erklärte Dohle.
So argumentieren auch andere. Mit der Novelle des Bundesjagdgesetzes würden die Weichen für die Zukunft des Waldes gestellt, sagte der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck. Und der Präsident des Waldeigentümer-Verbands AGDW, Hans-Georg von der Marwitz, forderte, „alle Möglichkeiten zu ergreifen“, um den Wald zu erhalten. Beide sind sich einig, dass ausdrücklich auch Mischbaumarten „im Wesentlichen ohne Schutz“ aufwachsen können sollten und es „Vegetationsgutachten als objektive Grundlage“ brauche.
Etwas anders sieht das der Deutsche Jagdverband. Der stellvertretende Geschäftsführer Torsten Reinwald lobte, dass vor Ort über die Jagd entschieden werden solle, denn die Situation der Wälder sei sehr unterschiedlich. Um aus Nadelholz-Monokulturen oder Schadflächen Mischwälder zu machen, müsse gesät oder angepflanzt werden. „Auf diesen Flächen sind wir gefordert, da muss intensiver gejagt werden“, sagte er. Es brauche aber weitere Schutzmaßnahmen, etwa, um Laubbäume vor anderen Pflanzen zu schützen, die sie sonst verdrängten.
„Einfach nur zu sagen, wir schießen Rehe und Hirsche, dann wächst der Wald, das funktioniert nicht“, sagte Reinwald. „In einer Kiefer- oder Fichten-Wüste einen ungeschützten Laubbaum zu pflanzen, ist, wie einem Schokoladen-Liebhaber eine Schüssel Pralinen vorzusetzen.“ In ein Jagdkonzept müsse auch einfließen, ob es Ruhezonen gebe für das Wild und ausreichend Futter, oder ob Bereiche besonders durch Tourismus oder Verkehr belastet seien. Eine Ausweitung der Jagdzeiten könne sogar zu mehr Verbiss führen, wenn Rehe und Hirsche auch im Winter gestresst würden und deswegen Futter bräuchten.
Es gibt allerdings auch Jäger, die das anders sehen. Es gehe darum, dass die naturnahe Entwicklung des Walds Priorität vor „Interessen von rückwärtsgewandten Vertretern einer überholten Hege- und Trophäenjagd“ erhalte, sagte die Vorsitzende des Ökologischen Jagdverbands, Elisabeth Emmert. Wenn die Verantwortung für eine „konsequent waldfreundliche Jagd“ auf die Akteure vor Ort verschoben werde, werde die Politik ihrer Verpflichtung nicht gerecht.
© dpa-infocom, dpa:200802-99-11803/3



